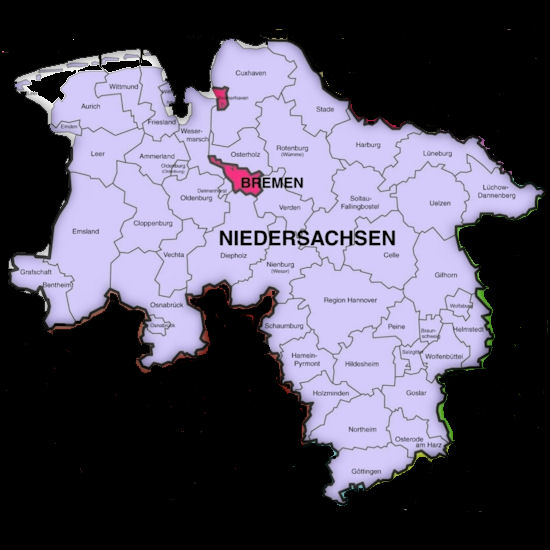|
Landkreis Ammerland - Dreibergen am Zwischenahn
- Das mit 2 ha recht kleine Schutzgebiet besteht aus drei bewaldeten urgeschichtlichen Grabhügeln am Rande des Zwischenahner Meeres, unter dessen alten Bäumen eine rund 1.000jährige Linde besonders herausragt.
Landkreis Vechta - Hünengrab in Neuenwalde
- Bei den Großsteingräbern Hünensteine I + II bei Damme, (auch Hünengrab Neuenwalde I + II genannt) handelt sich um neolithische Ganggräber. Sie entstanden zwischen 3500 und 2800 v.u.Z. und sind Megalithanlagen der Trichterbecherkultur. Die Hünensteine liegen südwestlich von Damme, nahe der L846 Osnabrück – Damme zu beiden Seiten der dort abzweigenden K277 (nach Össenbeck), im niedersächsischen Landkreis Vechta.
Landkreis Osnabrück - Hünengrab zu Hekese
- Ein Hünengrab aus der jüngeren Steinzeit. Etwa 4500 Jahre alte seltene, einzigartige Anlage in Westdeutschland. Zwei Großkammern (Grab A: 20m x 3m, Grab B: 19m x 3,5m/2,7m) an beiden Enden, verbunden durch einen 53m langen Steingang, im 19. Jahrhundert leider .T. durch Sprengung zerstört. Vom Aufbau her darf man hier von einem Alignement sprechen. Angeblich zur Entstehungszeit auf Sonnenuntergang am 21. Juni ausgerichtet.
Kreisstadt Osnabrück - Kalkriese und die Varusschlacht
- Die Fundregion Kalkriese ist ein Areal in der Kalkrieser-Niewedder Senke in Bramsche im Osnabrücker Land, in dem größere Mengen römischer Funde gemacht wurden. Es handelt sich neben dem Römerlager Hedemünden, dem Römerlager Bentumersiel und dem Schlachtfeld bei Kalefeld um eine der wenigen größeren römischen Fundstellen im norddeutschen Raum. In der Zeit der Römer in Germanien fand eine Reihe großer Schlachten in Germania Magna statt. Das Gebiet gilt vielen Wissenschaftlern als möglicher Schaupatz der Varusschlacht des Jahres 9 n. Chr., anderen Forschern als Hinweis auf die Schlacht des Caecina oder die Schlacht am Angrivarierwall. Auch wenn die Diskussion nicht abgeschlossen ist, hält dennoch die große Mehrheit der Historiker einen Zusammenhang zwischen Kalkriese und der Varusschlacht aufgrund einer Reihe von Indizien zumindest für eine plausible Hypothese. Die wichtigsten Zeugen und einzige verlässliche Basis zur Datierung der Geschehnisse sind die gefundenen Münzen, von denen viele einen VAR (VARus) oder VAL (VALa) Gegenstempel aufweisen, also Varus selbst oder aber seinem Legaten Vala zugeordnet werden können. Münzen nach 10 bis 15 n. Chr. wurden bisher nicht entdeckt, so dass dieser Umstand zur Interpretation benutzt wird, dass eine Schlacht nicht nach 9 n. Chr stattgefunden haben kann. Die Datierung der Münzen und die Entdeckung der Knochengruben, die anthropologischen Befunde und die Untersuchungen der gefundenen Tierknochen deuten darüber hinaus darauf hin, dass Kalkriese möglicherweise der Ort der Varusschlacht ist. Die Streuung der Funde passt zu dem Schlachtgeschehen, das sich über vier Tage an unterschiedlichen Orten ereignete. Eine Ausstellung im mehrfach preisgekrönten Museumsgebäude von Museum und Park Kalkriese in Bramsche präsentiert mit modernen Medien Geschichte und Forschungsergebnisse. Der 24 Hektar große Park verknüpft das Geschehen von einst mit der Gegenwart. Museum und Park Kalkriese bieten zugleich zahlreiche kulturelle Veranstaltungen: Feuerwerke, Konzerte, Vorträge, Sonderausstellungen. Und besondere Erlebnisse für Gruppen: Klettern im Hochseilgarten, Feuer machen ohne Streichhölzer, Fackelführungen, Kochen wie Römer und Germanen.
Landkreis Cloppenburg - die Megalithen bei Lastrup
- Nicht so sehr viel zu sehen gibt es bei diesem Rest einer Steinkammer. Nur der Abschlussstein sowie die beiden anschließenden Wandsteine sind auszumachen. Es handelt sicher hierbei um das östliche Ende der Kammer. Diese Steine liegen nur ein paar Meter östlich von den beiden Lastrup-Anlagen. In einem benachbarten Hügel ragen auch einige Findlinge aus dem Boden. Da aber in der Literatur nichts weiter angegeben ist, sind diese wohl nicht von Bedeutung.
Landkreis Emsland - Kunkenvenne bei Thuine
- Das Großsteingrab in der Kunkenvenne wurde 1841 "unstreitig wohl als das größte und großartigste" im damaligen Königreich Hannover genannt. Und in der Tat ist es nicht nur ein sehr gut erhaltenes und äusserst eindrucksvolles, sondern auch einzigartiges Denkmal, das aus dem Ende der Jungsteinzeit stammt. Es besteht aus 17 Jochen, d.h. Tragsteinpaaren plus Decksteinen. Die Kammer ist 27 Meter lang. Hier in Thuine sind die umringenden Steinkränze noch sehr gut erhalten. Das es zwei sind, ist zudem besonders. Eine typische Bauform der Großsteingräber ist die Emsländer Kammer. Es sind Ganggräber mit Innenmassen über 20m Länge, 2m Breite und 1m Höhe. Sie sind meist ost-westlich ausgerichtet und haben einen Zugang von der südlichen Seite in der Mitte des Ganges. Sie lagen ursprünglich in einem langen, ovalen Hügel, der von kleinen Findlingen umgeben war. Manchmal gibt es doppelte oder dreifache Kammern. Als Baumaterial dienten die Findlinge, die die Gletscher der vorletzten Eiszeit (Saale-Eiszeit) vor etwa 200000 Jahren aus Skandinavien antransportiert hatten. Diese Grabanlagen wurden von den ersten Bauern der Region erbaut. Sie dienten mehreren Generationen einer Sippe als Bestattungsplatz. Von den Skeletten ist wenig erhalten, da der Boden wenig Kalk enthält.
Es waren seßhafte Ackerbauern und Viehzüchter, die in einem jüngeren Abschnitt der Jungsteinzeit, der jungsteinzeitlichen Trichterbecherkultur zwischen 3400 und 2800 v.u.Z., deren handwerkliche Fähigkeiten, z.B. bei der Gefäßherstellung, bewundernswert sind. Die Keramik, dieser Zeit, die nach einer charakteristischen Gefäßform "Trichterbecherkeramik" genannt wird, ist sehr qualitätsvoll gearbeitet. Ohne Töpferscheibe, bzw. lediglich auf einem drehbaren Untersatz stellten die jungsteinzeitlichen Töpfer dünnwandige, gleichmäßig geformte Gefäße her, die sie vor dem Brennen schön verzierten.
Landkreis Grafschaft Bentheim - das Gräberfeld am Spoellberg
- Das Gräberfeld am Spöllberg (Spielberg) liegt nordwestlich von Nordhorn und südlich von Gölenkamp, auf einer Heide mit Wacholderbestand im Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen. Es besteht aus acht Hügelgräbern, deren zentral gelegener Hügel durch seine Höhe von 2,5 m auffällt. Der kleinste, im Norden weist nur 60 cm Höhe auf. Die weiteren Hügel zeichnen sich im Gelände durch deutlichere Wölbungen ab. Bei zumeist unsystematischen Grabungen und bei der Ausgrabung von J. H. Müller im Jahre 1877 sind am Spöllberg immer wieder Funde und Befunde gemacht worden, deren zeitliche Einordnungen vom späten Neolithikum (Felsgesteinaxt der Einzelgrabkultur) bis ans Ende der Bronze- oder den Beginn der Eisenzeit reichen. Ein Aufsehen erregender Fund kam 1840 bei Sandabgrabungen zu Tage. Man fand einen mit schwarzer Erde gefüllten goldenen Becher, der als Deckel über ein mit weißem Sand gefülltes, bei der Bergung zerbrochenes Gefäß gestülpt war. Es wurde von Fürst Ludwig zu Bentheim-Steinfurt (1812-1890) angekauft. Der als „Goldbecher aus Gölenkamp“ berühmt gewordene 11 cm hohe, (14,0 cm Mündungsdurchmesser) und 255 Gramm schwere, konische Becher wurde in Treibarbeit hergestellt. Unter dem Rand umlaufend befinden sich vier schmale Wülste. Darunter wechseln sich drei umlaufende Buckelreihen mit stärkeren Wülsten ab, die durch glatte Ringe getrennt sind. Das untere Drittel der Wandung ist glatt. Der Standboden ist mit drei konzentrischen Rillen verziert.
Landkreis Leer - der sagenumwobene Plytenberg
- Der Plytenberg, um den sich viele Sagen drehen, ist neun Meter hoch und hat einen Durchmesser von ca. 64 Metern. Es wird vermutet, dass der Plytenberg einst als Ausguck für die Festung Leerort diente. Eine Sage berichtet jedoch von den „Erdmanntjes“, kleinen Kobolden, die dort gewohnt haben sollen.
Die Erdmantjes (aus dem Ostfriesischen Lesebuch)
Vor mehr als fünfhundert Jahren wohnten noch die Erdmantjes im Plytenberg. Sie hatten tief im
Berge ein wunderschönes Schloß von Marmor und Gold, und mittendrin war ein großer Saal,
dessen Wände waren blau wie der Himmel, und drinnen leuchteten gleich Sonnen unzählige
Edelsteine. Hier lag König Radbods verschwundener Schatz, der den ganzen großen Fußboden
füllte und wie Meeresflut meterhoch an den Wänden emporstieg. Alles glitzerte und gleißte so,
daß einem die Augen wehtaten und man fürchten mußte, blind zu werden.
Die Erdmantjes, die unter ihrem König Sjurt den Schatz bewachten, bekam man sehr selten zu
sehen. Einmal, es war in der Paskezeit, ging eine Schar Knaben aus Leer an den Plytenberg, um
dort mit ihren bunten Eiern zu lönsken. Da sahen sie, wie vor einem großen Loche zwei
Erdmantjes mit grauen Kitteln, Zipfelmütze und langen Bärten saßen und sich in der Märzsonne
wärmten. Als sie sich jedoch von den Kindern überrascht sahen, huschten sie wie Wiesel in die
Erde. Die Jungen liefen schnell zurück und schrien: „Wir haben die Erdmantjes im Plytenberg
gesehen!“ Und im Laufe des Tages wanderten viele Neugierige hinaus, um sich das Erdloch
anzusehen.
Die Leute mochten die Erdmantjes gerne leiden, und wenn sie in Not kamen, gingen sie nachts
so um zwölf hinaus auf den Plytenberg, verneigten sich dreimal nach Osten und
riefen: „Erdmantje, Erdmantje, help mi! Kumm na min Hus, ik bä di!“
Zu Hause mußten dann sämtliche Türen offenstehen und alle Lichter gelöscht sein, keiner
durfte mehr außerhalb des Bettes sein. Wenn man dann zurückkam, waren die Erdmantjes
inzwischen dagewesen und hatten die Menschen oder Vieh wieder gesund gemacht.
Landkreis Aurich - das Grosssteingrab zu Tannenhausen
- Das Großsteingrab Tannenhausen (im Volksmund auch Butter, Brot und Käse (Ostfr. Plattdeutsch Botter, Brood un Kääs) genannt) sind zwei große Megalithanlagen aus der Vorzeit, die eng benachbart bei dem kleinen Ort Tannenhausen, 4,3 km nördlich von Aurich, einer Kreisstadt in Ostfriesland liegen. Die beiden Anlagen wurden 1962 und 1963 unter Leitung der Ostfriesischen Landschaft erforscht. Im Steingrab wurden Keramik der Westgruppe der Trichterbecherkultur – Schalen, Trichterbecher, Schultergefäße, und Kragenflaschen – sowie Steingeräte gefunden. Sie zeigen, dass das Grab rund 5000 Jahre alt ist. Die Fundstücke werden im Historischen Museum Aurich ausgestellt. Obwohl es in Ostfriesland zahlreiche Trichterbecher-Fundplätze gibt, sind nur noch drei weitere ehemalige Standorte (Brinkum, Leer und Utarp) von Großsteingräbern bekannt, die vollkommen zerstört sind (bis auf die Reste in Tannenhausen). Es wird vermutet, dass die meisten Grabanlagen in der steinarmen Gegend Ostfriesland im Zuge der Christianisierung und des damit einhergehenden Kirchenbaus, aber auch beim späteren Hafen- und Deichausbau, zerstört worden sind. Vom Großsteingrab in Tannenhausen sind heute nur noch zwei Decksteine und ein Tragstein erhalten. Diese erhaltenen Steine gehören zur westlichen Kammer. Bei den Ausgrabungen, Anfang der 1960er Jahre konnten die Standgruben der fehlenden Tragsteine nachgewiesen werden. Zudem stellte sich heraus, dass daneben ein zweites Grab gestanden hat. Dieses wurde nach der Untersuchung so rekonstruiert, wie es nach der Fertigstellung in einem Erdhügel ausgesehen hat.
Landkreis Wittmund - die Grabhügel von Rispel
- Die Hügelgräber bei Rispel befinden sich im Bereich des Knyphauser Walds südlich von Rispel, einer Ortschaft in der Gemeinde Wittmund in Niedersachsen. Sie stammen aus der Bronzezeit. Von den ursprünglich etwa 100 Hügeln blieben nur einige erhalten. Die übrigen wurden um 1900 eingeebnet.
Landkreis Friesland - der Jedutenhügel bei Rotenhahn
- Der Jedutenhügel ist ein Denkmaltyp, der in den Landkreisen Friesland und Wesermarsch in Niedersachsen vorkommt. Die Entstehungszeit und die Funktion dieser künstlich aufgeworfenen Hügel, die Höhen bis zu 6 m und Durchmesser bis zu 30 m erreichen können, ist nicht geklärt. Die Deutungen reichen von Gerichtsstätten über landfeste Seezeichen bis hin zu Signal- oder Alarmplätzen, wie etwa Warten, von denen aus die Bewohner vor Gefahren gewarnt wurden. Diese Vermutung lag nahe, da die Wikinger zur Zeit Karls des Großen die Küste Butjadingens häufiger heimsuchten. Im Volksglauben werden sie auch als Begräbnisplätze angesehen. Der erste, der sich in einer Schrift aus dem Jahre 1923 mit dieser Art von Hügeln auseinandersetzte, war der Studienrat Heinrich Lübben aus Bremerhaven. Jedutenhügel gab oder gibt es etwa in folgenden Ortschaften: Nordenham-Grebswarden (Wesermarsch) oder in Varel-Jeringhave, am Abzweig nach Rotenhahn liegt an der B 69 ein friesländischer Jedutenhügel. Der aufgeschüttete, steile Hügel liegt auf dem höchsten Punkt einer natürlichen Geländekuppe und hat bei 17 m Durchmesser eine Höhe von 3,5 m.
Kreisstadt Wilhelmshaven - Burg Kniphausen in Fedderwarden
- Die Burg Kniphausen in Fedderwarden im Stadtgebiet von Wilhelmshaven in Niedersachsen wurde 1438 gebaut und hatte schließlich „das typische Bild eines Adelssitzes der Spätrenaissance“.[1] 1666/67 wurde sie zur Festung mit vier Eckbastionen ausgebaut. Die Burg war lange Zeit Mittelpunkt und Regierungssitz der Herrlichkeit oder Herrschaft Kniphausen. Die Herrschaft Kniphausen, bis ins 17. Jahrhundert auch „Herrlichkeit von In- und Kniphausen“ genannt, war ein Teil Frieslands und wurde von friesischen Häuptlings- und Adelsfamilien regiert. Sie lag in der Östringer Marsch, am Stadtrand und zum Teil auf dem heutigen Stadtgebiet von Wilhelmshaven. Die Herrlichkeit entstand gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Erster Herr war der friesische Häuptling Fulf von In- und Kniphausen (etwa 1465-1530/31), der durch Erbschaft in den Besitz der Burgen Inhausen und Kniphausen gelangte. Zu dieser Zeit umfasste die Herrlichkeit eine Fläche von etwa 45 km² mit den Kirchspielen Fedderwarden, Sengwarden und Accum. Heute existiert von der ursprünglichen Burg nur noch der ehemalige Marstall mit dem Treppenturm und ein Torhaus. Die Burg liegt auf dem Gebiet der Stadt Wilhelmshaven und befindet sich in Privatbesitz. Lediglich der sogenannte Ahnensaal und einige Nebenräume gehören der „Stiftung Burg Kniphausen“, die diese für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen zur Verfügung stellt.
Weiter und zurück ...
|